
Während vor dem rigorosen Vorgehen der USA in Antigua und Barbuda noch rund 100 Online-Glücksspiel Unternehmen auf den Inseln tätig waren, schrumpfte dies danach auf gerade einmal 40 herunter.
Die WTO gab Antigua und Barbuda recht, doch die USA ignoriert bis heute sämtliche Urteile
Im Jahr 2004 zog Antigua und Barbuda vor die Welthandelsorganisation und berief sich auf die geltenden WTO-Regeln zum freien Verkehr von Dienstleistungen. Schließlich hatte sich die USA in der Vergangenheit dazu entschlossen, diese selbst zu unterzeichnen. Durch die Abschottung und der damit verbundenen Aussperrung von ausländischen Glücksspielunternehmen vom US-amerikanischen Markt, wurde gegen eben diese Regel verstoßen. Dieser Meinung von Antigua und Barbuda folgte ebenfalls das WTO-Gericht und verdonnerte die USA zu einer jährlichen Strafzahlung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar, bis der Missstand beseitigt ist. Wie wir Zocker wissen, hat sich seitdem an den restriktiven Glücksspielgesetzen gegen Online Casinos und Sportwetten bis heute rein gar nichts getan. Zudem ignoriert die USA seit 2004 die Entscheidung der WTO und hat bis heute keinen einzigen Cent herausgerückt. Und so belaufen sich die Schulden des Landes beim kleinen Inselstaat auf mittlerweile über 250 Millionen Dollar. Theoretisch könnte Antigua und Barbuda dieses Geld auf anderem Wege eintreiben, denn mit Bitten und Hoffen wird es wohl nicht gelingen. Denn mit einer Bestätigung des WTO-Urteils gegen die USA 2007 bekam die kleine Nation mit 85.000 Einwohner ein mächtiges Werkzeug in die Hand gedrückt. Dieses erlaubt Antigua und Barbuda sämtliche Urheberrechte und Lizenzen US-amerikanischen Eigentums zum eigenen Profit nutzen. Und dies pro Jahr im Gesamtwert von eben den 21 Millionen US-Dollar, die die USA dem Inselstaat schulden. Dadurch könnte das Land Kinofilme, Musik oder Patente kostenlos fürs eigene Staatssäckel nutzen. Doch bis heute hat sich Antigua und Barbuda davor gescheut, dies tatsächlich umzusetzen. Wohl zu groß ist die Gefahr, ins Radar der nicht immer friedvollen US-amerikanischen Außenpolitik zu geraten. Doch eine nun von einem US-Gericht getroffene Entscheidung könnte neuen Schwung in die ganze Angelegenheit bringen.
Auf den ersten Blick mögen die 21 Millionen US-Dollar nicht gerade üppig erscheinen. Doch für Antigua und Barbuda bedeuten diese rund 15 Prozent des jährlichen Haushalts. Noch immer ist der Glücksspielsektor auf dem Inselstaat nach dem Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig.
Calvin Ayre im Visier der US-Behörden
Das gnadenlose Vorgehen der USA gegen jegliche Form von Online Casinos verstärkte sich 2006 mit dem Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA). Von nun an gingen die Behörden immer massiver gegen ausländische Anbieter vor und der Höhepunkt war hier 2011 die Beschlagnahmung der Domains von Pokerstars.com und dreier weiterer Anbieter. Daraufhin zogen sich die meisten Betreiber aus dem Land zurück, obwohl dieses Gebaren der US-Justiz klar gegen die geltenden WTO-Bestimmungen verstießen. Wie immer wurde hier vonseiten des FBI und der Regierung die Karte der angeblichen Geldwäsche gespielt. Ein weitere Name, der ebenfalls massiv unter die Räder der US-Justiz geriet war Calvin Ayre, der Gründer von Bodog. Zu Beginn der 2000er Jahre gehörte er zu den größten Anbieter von Online Glücksspielen und begann Bodog zu einer globalen Marke auszubauen, ähnlich wie Virgin, welches sein Vorbild damals darstellte. Aufgrund der damaligen, weitaus einfacheren Konkurrenzsituation im Online Casino Sektor, baute Ayre sein Glücksspielunternehmen von Jahr zu Jahr massiv aus. So konnte das Unternehmen 2005 mehr als 7 Milliarden US-Dollar an Wetten und Online Glücksspielen umsetzten und daraus 214 Millionen US-Dollar an Profit erwirtschaften. Davon wanderte allein rund 55 Millionen US-Dollar in die privaten Taschen von Calvin Ayre. Bereits nur zwei Jahr später beliefen sich die gesamten Wetten und Glücksspieloperationen von Bodog auf gigantische 24 Milliarden US-Dollar, mit 640 Millionen US-Dollar Gewinn. Dieses mal blieben gleich rund 160 Millionen US-Dollar für den Online Casino Papst hängen. Kein Wunder bei diesem Summen, dass Ayre immer mehr in den Fokus der US-Justiz geriet und dies am 2012 zu einer Anklage führte.
Calvin Ayre scheute niemals das Rampenlicht und posierte sehr gern mit seinem Reichtum, um sich selbst ein besonderes Image zu verpassen. So zierte sein Gesicht 2006 das Forbes Magazin, mit begleitender Hauptgeschichte über ihn und 2007 fand er sich im Star Magazin „Most Eligible Billionaire Bachelors“ wieder. Doch abseits all dieser Boulevard-Vergnügen tauchte sein Name ebenfalls später in den berühmten Panama Papers von 2016 auf. Bei denen herauskam, dass Ayre über ein gigantisches Netzwerk an Offshore-Firmen verfügt.
Antigua und Barbuda begrüßen Urteil im Fall Calvin Ayre
Calvin Ayre wurde 2012 in Maryland angeklagt, über Bodog US-amerikanischen Bürgern Glücksspiele in Online Casino angeboten zu haben. Dies war natürlich zutreffend, denn anders als Pokerstars und andere Anbieter, weigerte sich Ayre seine Dienste in den USA einzustellen. Doch wie bereits 2004 die Welthandelsorganisation feststellte, verstößt diese Gesetzgebung gegen das Online Glücksspiel gegen geltendes WTO-Recht. Und so wurde seit Jahren ein Urteil in diesem Fall mit Spannung erwartet. Nun ist diese mehr oder weniger endlich erfolgt. Denn gegen eine Zahlung von 500.000 US-Dollar lies die Justiz die Vorwürfe gegen Calvin Ayre fallen. Zum einen entgeht die US-Justiz damit dem schwierigen Umstand, dass die eigenen Gesetzgebung gegen internationales Recht verstößt. Zum anderen kann der aussichtslose Kampf, Ayre endlich habhaft zu werden, mit einer Wahrung des Gesichts aufgegeben werden. Denn Calvin Ayre lebte bereits seit 2007 in Antigua und Barbuda und gilt dort als wichtiger Investor. Aufgrund der langjährigen Streitigkeiten mit den USA, konnte Ayre sicher sein, niemals an die USA ausgeliefert zu werden. In dem Fallenlassen der Anklage sieht die Regierung des Inselstaates nun eine perfekte Gelegenheit, wieder einmal den Fokus auf die immer noch andauernde Zahlungsverweigerung der USA hinzuweisen. Gleichzeitig vermeldeten Regierungsvertreter, weiterhin daran zu arbeiten, den Streit mit den Vereinigten Staaten von Amerika so schnell wie möglich beizulegen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, wovon auszugehen ist, dann wird dies demnächst erneut vor der WTO zur Sprache kommen. Ob jedoch Antigua und Barbuda jemals Urheberrechte und Lizenzen amerikanischer Firmen benutzen wird, ist weiterhin fraglich. Denn um sich mit den USA offen anzulegen, ist der kleine Inselstaat wohl einfach zu klein.
Gleichzeitig mit dem Ende des Prozesses in den USA, erwarb Calvin Ayre ebenfalls die Rechte an der Marke Bodog zurück. Diese wurde 2012 mit dem Beginn der Anklage gegen ihn beschlagnahmt. Für 100.000 US-Dollar konnte er diese nun wieder in den eigenen Besitz bringen.
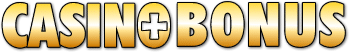






























Hinterlasse einen Kommentar