
Für die Datenerhebung wurden 10.000 und 11.500 Menschen nach ihren Gewohnheiten zum Glücksspiel befragt. Hier kam mit dem SOGS ein Fragebogen zum Einsatz, der darüber Auskunft geben soll, ob es sich bei dem Befragten um einen problematischen oder pathologischen Glücksspieler handeln könnte. Bis 2011 wurden die Datenerhebung und Befragung ausschließlich über das Festnetz erhoben, seit 2013 erfolgt dies in der Dual-Frame Methode gemischt mit Mobilfunkanschlüssen. Bei einem Rückgang von fast der Hälfte aller Spielsüchtigen in Deutschland, ist es mehr als fraglich, ob die restriktiven Maßnahmen gegen die Spielhallen tatsächlich gerechtfertigt sind.
Männer sind deutlich stärker von Glücksspielsucht betroffen
Im nun vorgestellten Drogen- und Suchtbericht 2017 wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Männer überproportional gegenüber Frauen von der Spielsucht betroffen sind. Während bei den Frauen die Gesamtzahl an problematischen und pathologischen Glücksspielern nur 0,25 Prozent aller weiblichen Einwohner in Deutschland ausmacht, liegt der Wert bei Männern bei 1,34 Prozent. Damit ist die Wahrscheinlichkeit für Männer, einen teilweisen oder vollständigen Kontrollverlust bei Glücksspielen zu erleiden, um mehr als das Fünffache erhöht. Noch gravierender ist die Differenz allein beim pathologischen Glücksspiel, was als tatsächliche Glücksspielsucht definiert wird und den vollständigen Verlust der eigenen Kontrolle über das Zocken bedeutet. Hier haben Männer mit einem Wert von 0,68 Prozent, gegenüber einem Wert von 0,07 Prozent bei Frauen, eine fast zehnfach höhere Wahrscheinlichkeit an Spielsucht zu erkranken. Beim problematischen Spielverhalten, was oft, aber nicht immer, ebenfalls mit der Zeit zur Glücksspielsucht führen kann, wiegt der Unterschied mit 0,66 Prozent bei Männern und 0,18 Prozent bei Frauen deutlich geringer. Daraus ergibt sich aus der Studie der BZgA, wie der Drogen- und Suchtbericht 2017 vermerkt, folgendes Bild. Der typische Glücksspieler mit einem mindestens problematischen Spielverhalten ist zu 84,7 Prozent männlich und zockt zu 64,4 Prozent mehr als nur ein Glücksspiel. Außerdem setzt er dabei zu 54,4 Prozent mehr als 100 Euro im Monat ein und spielt dabei zu 53,7 Prozent regelmäßig. Des weiteren kommt der Drogen- und Suchtbericht 2017 zu dem Schluss, das vor allem ein geringer Bildungsgrad, nicht höher als Hauptschulabschluss und ein Migrationshintergrund signifikant die Wahrscheinlichkeit erhöht an einer Glücksspielsucht zu erkranken.
Um herauszufinden ob einer der Befragten ein problematisches oder pathologisches Spielverhalten aufweist, wird bei der Befragung auf den SOGS-Fragebogen zurückgegriffen. Wer von uns Spielern 5 oder mehr der 20 Fragen mit Ja beantwortet gilt als glücksspielsüchtig. Bei 3 bis 4 Antworten mit Ja wiederum kann ein problematisches Spielverhalten diagnostiziert werden.
Fragen die im SOGS vorkommen können sind beispielsweise:
- Haben Sie jemals behauptet, dass Sie beim Spielen Geld gewonnen haben, obwohl sie in Wirklichkeit verloren haben?
- Hatten Sie jemals mehr gespielt, als Sie beabsichtigt hatten?
- Haben Sie jemals Spielbelege, Lotterietickets, Spielgeld, Schuldscheine oder andere Anzeichen für Wetten oder Spielen vor Ihrem Ehe- oder Lebenspartner, Ihren Kindern oder anderen wichtigen Personen aus Ihrem Leben versteckt?
Lesen Sie in unserem zweiten Teil über die äußerst fragwürdigen Zahlen, die der Drogen- und Suchtbericht 2017 über die Sozialen Kosten des Glücksspiels verwendet.
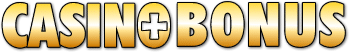












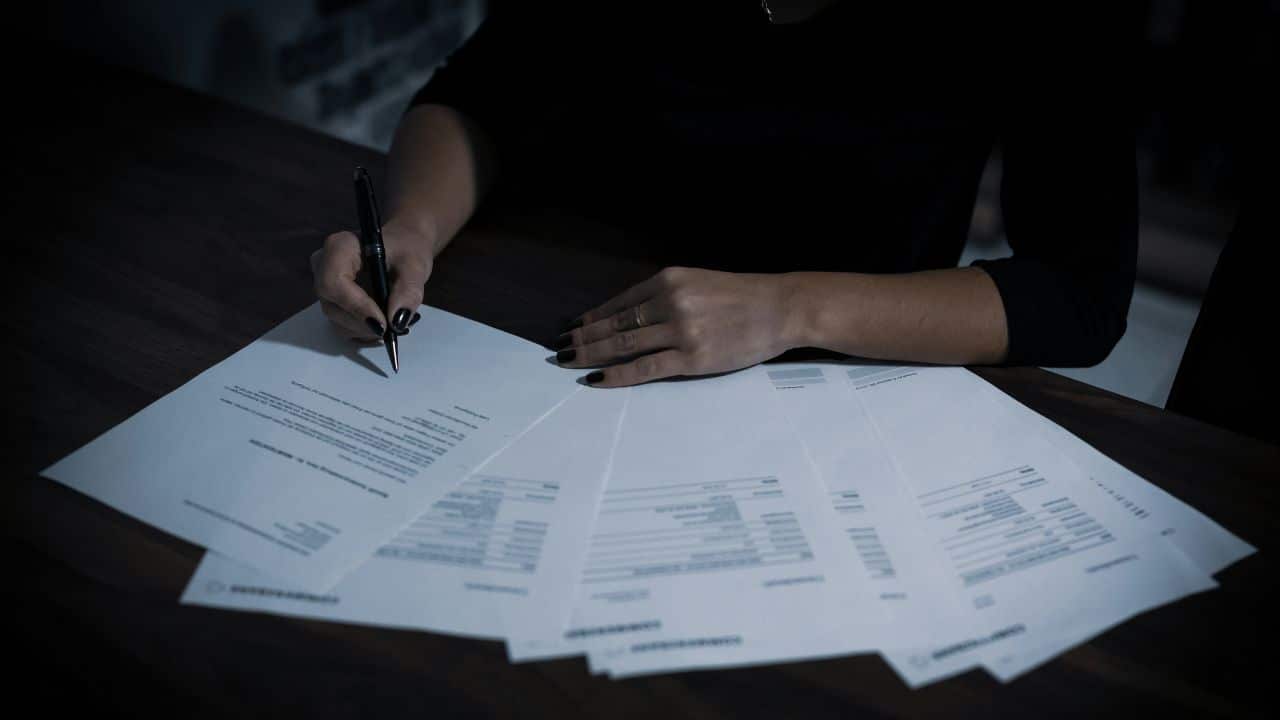



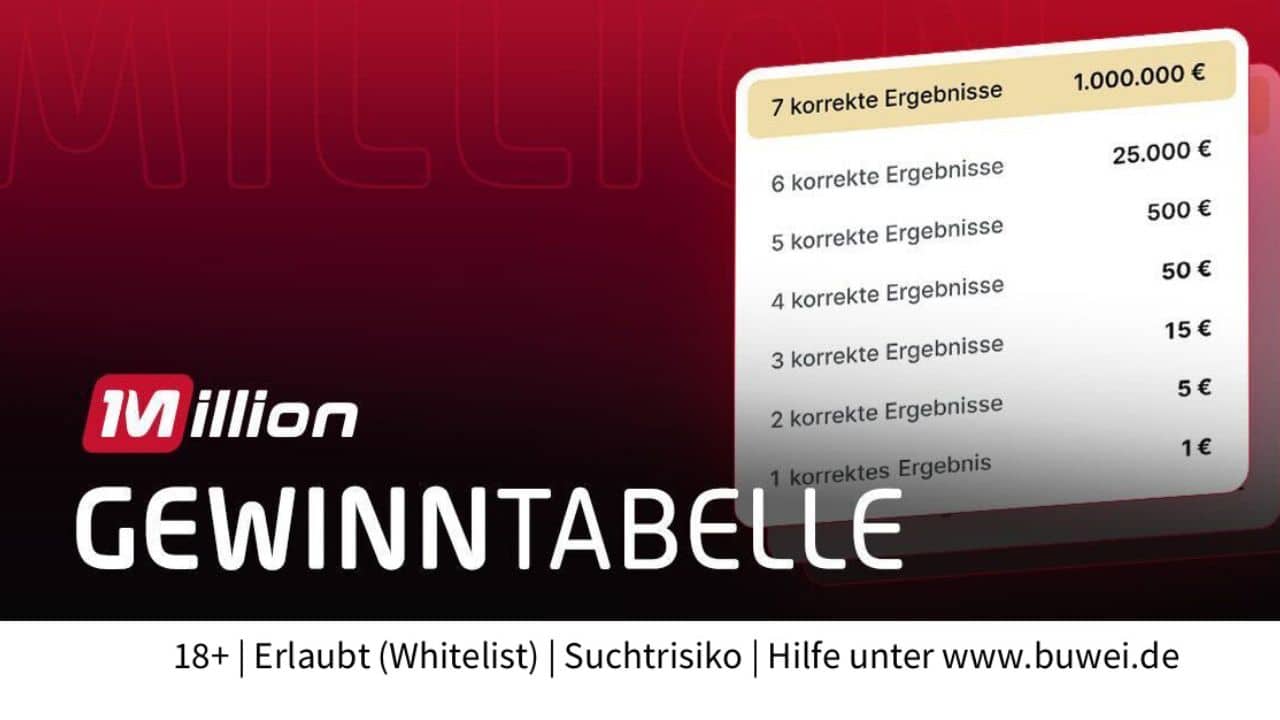



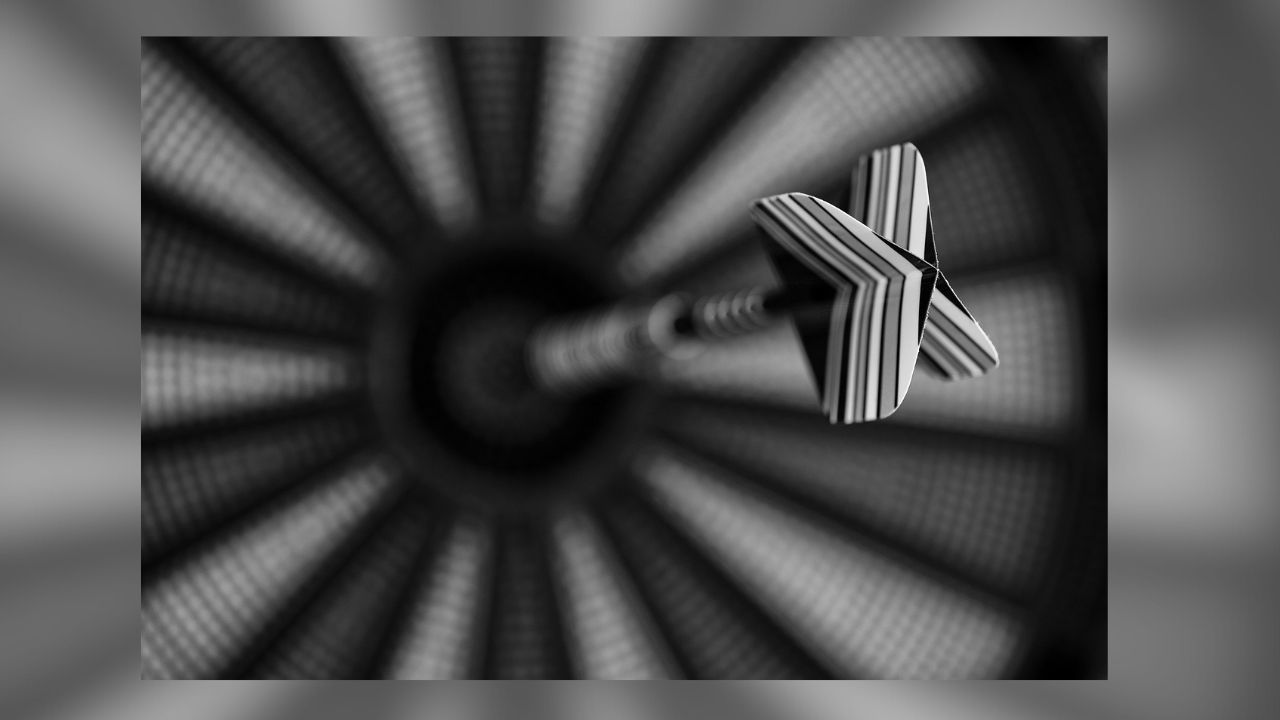









Hinterlasse einen Kommentar