
Scheitert der Glücksspielstaatsvertrag 2021? Aktuell steht die Zukunft des Glücksspiels auf der Kippe. Scheitert der Vertrag 2028, dann kehrt Deutschland zum Regel-Flickenteppich zurück. (Bildquelle: Aymanejed auf Pixabay)
Platzt der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) 2028? Mit dieser Frage muss sich die Glücksspielbranche in Zukunft beschäftigen. Denn sowohl 2026 als auch 2028 werden für den Staatsvertrag und seine weitere Handhabung relevant. Seit 2021 gilt der GlüStV, der ursprünglich dazu angedacht war, Ordnung in den Online-Glücksspielmarkt zu bringen. Klare Regeln, Spielerschutz und eine Behörde, welche die Aufsicht hat. Doch schon heute, einige Jahre nach der Einführung, zeigen sich Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Wir werfen einen Blick in das Jahr 2028. Was passiert, wenn der Staatsvertrag scheitert? Und wie realistisch ist es, dass danach Änderungen bevorstehen?
Glücksspielstaatsvertrag: Anspruch und Realität
Der Glücksspielstaatsvertrag regelt das Online-Glücksspiel in Deutschland. Fest verankert im Vertrag sind unterschiedliche Maßnahmen, die den Umgang mit Online Casinos und anderen Glücksspieleinrichtungen regeln sollen. Dazu gehören Einzahlungslimits, ein zentrales Sperrsystem und die Werbevorgaben. Sicherheit für Spieler und Betreiber war das zentrale Ziel. Doch die Praxis sieht etwas anders aus. Denn die Spieler empfinden die Maßnahmen als zu streng und wandern immer mehr zum Schwarzmarkt ab. Anbieter von Online Casinos und Spielhallen verlieren Nutzer und damit Einnahmen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Politik, denn denen fehlen dadurch Steuereinnahmen. Ist die Kanalisierung, also die Lenkung der Spieler zu den legalen Angeboten, damit gescheitert?
Der illegale Glücksspielmarkt ist trotz der Einführung des Staatsvertrags ein starkes Problem der Branche. Schätzungen zufolge liegt der aktuelle Anteil des Schwarzmarkts zwischen 30 und 40 Prozent. Insbesondere im Bereich Sportwetten geht man von einer noch höheren Quote aus. Sollte der Glücksspielstaatsvertrag scheitern, hätte das massive Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Fehlen die bundesweiten Rahmenbedingungen, droht ein Anstieg illegaler Plattformen. Der Schutz der Spieler entfällt dann völlig.

Scheitert der Glücksspielstaatsvertrag, drohen unkontrollierte Märkte, ein schwacher Spielerschutz und ein Flickenteppich an Regeln. (Bildquelle: Mariakray auf Pixabay)
2026 und 2028 sind die entscheidenden Jahre
Der Glücksspielstaatsvertrag war nie als Dauerlösung gedacht. Deswegen steht 2026 eine umfassende Evaluierung an, bei der unterschiedliche Aspekte des Vertrags geprüft werden. Bei der Evaluierung wird die Kanalisierungsquote geprüft und analysiert, wie erfolgreich der Spielerschutz wirklich ist. Außerdem wird erarbeitet, ob die Rahmenbedingungen für lizenzierte Anbieter wirtschaftlich tragfähig sind. Basierend auf diesen Ergebnissen müssen die Bundesländer anschließend entscheiden, wie es mit dem Staatsvertrag wirklich weitergeht. Um eine Weiterführung des Vertrags zu ermöglichen, müssen die Unterschriften von allen 16 Bundesländern vorliegen. Fehlt auch nur eine, platzt der Glücksspielstaatsvertrag.
Was droht bei einem Scheitern des GlüStV? Wenn der Vertrag 2028 nicht verlängert wird, hat das weitreichende Folgen für das Glücksspiel, wie wir es heute kennen. Es droht also die Rückkehr zum Flickenteppich. Jedes Bundesland könnte ab2028 also wieder eigene Regeln erlassen. Einheitliche Spielerschutzmechanismen wie OASIS könnten demnach entfallen. Illegale Anbieter hätten außerdem leichtes Spiel, da zentrale Lizenzierungen wegfallen. Ohne legale Anbieter entgehen dem Staat massive Steuereinnahmen.
Ohne ein neues und tragfähiges Regelwerk droht in Deutschland der Rückfall in rechtliche Unsicherheit. Doch was müsste sich ändern, damit der Staatsvertrag weiter bestehen bleibt? Die Regulierung des Glücksspielmarkts ist wichtig, jedoch muss sie smarter werden, damit sie für Online Casinos in Deutschland tragfähig wird. Mögliche Änderungen wären ein flexibles Einzahlungslimit. Statt eine pauschale Deckung zu nutzen, könnten individuelle Limits basierend auf dem Risiko eingesetzt werden. Auch die Benutzererfahrung muss sich verändern. Anmeldeprozesse sollten flüssiger werden, wodurch die Anmeldung leichter wird. Nur so kann der legale Markt weiterhin bestehen bleiben.
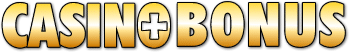
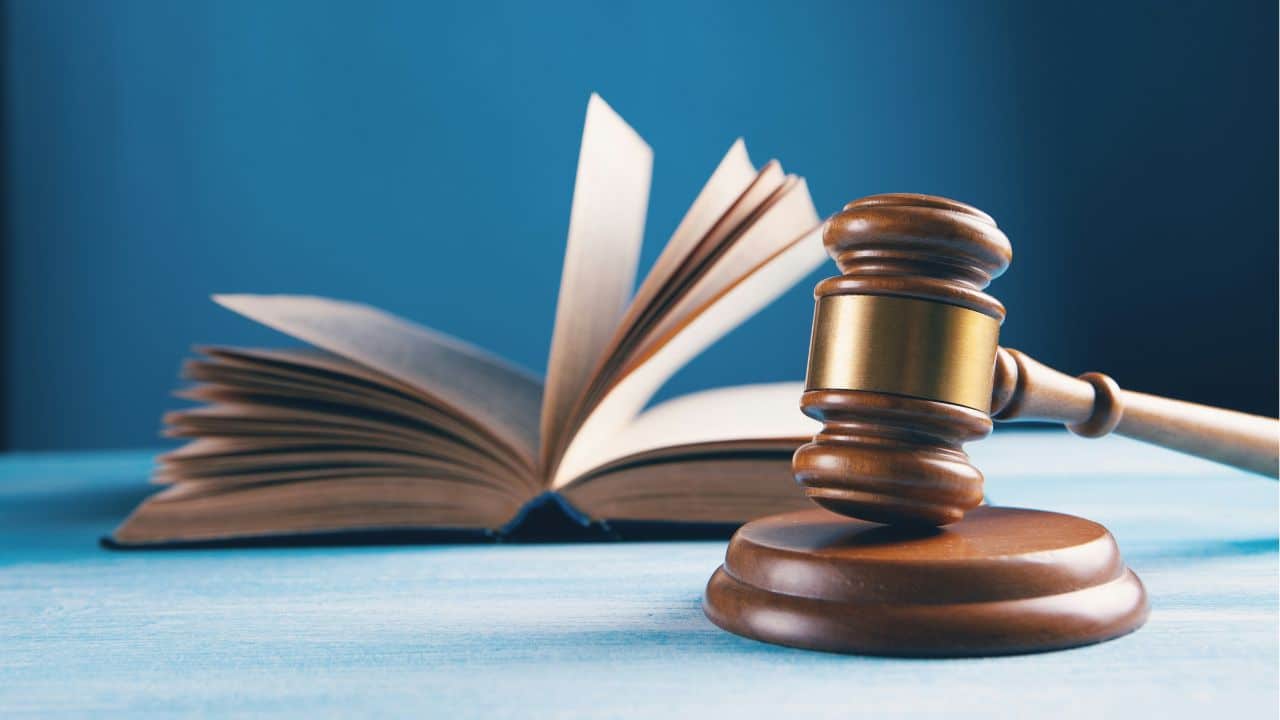











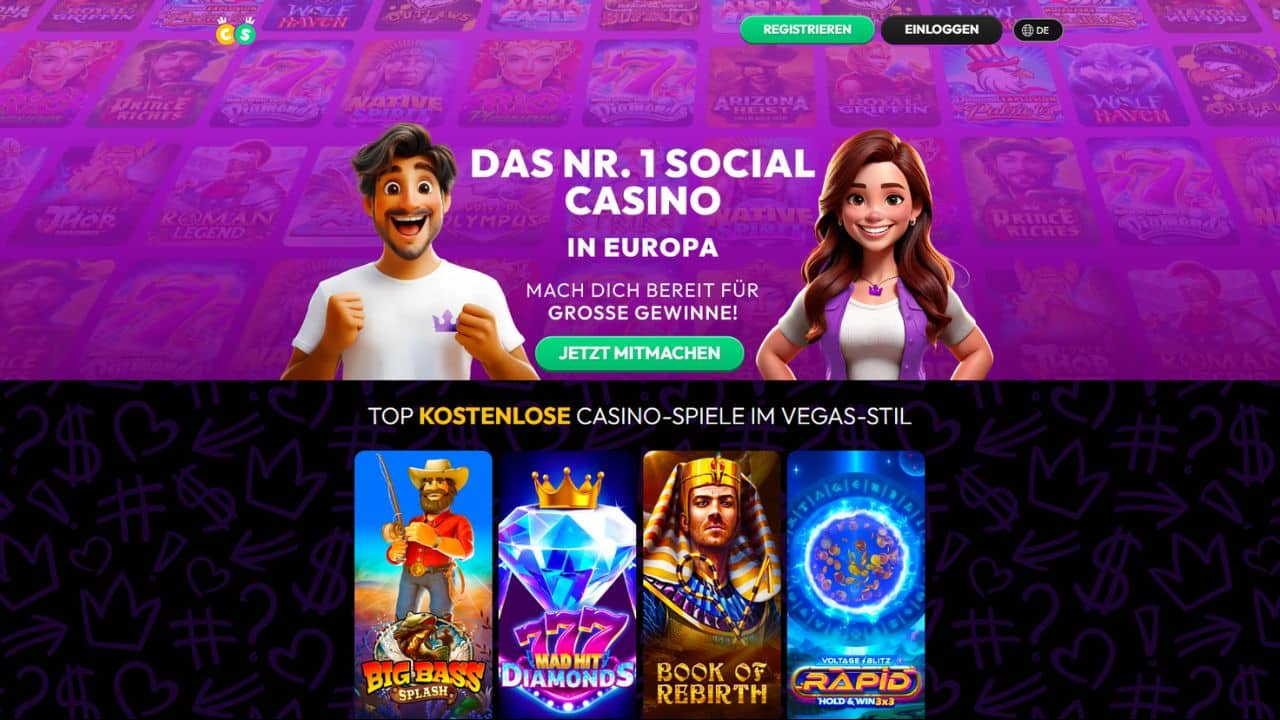

















Hinterlasse einen Kommentar